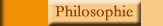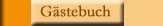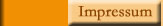Keulen-Bärlapp | Bärlapp
(Lycopodium clavatum) Naturschutz Stufe 3 in DE, AT und CH! Kraut: giftig +, Sporen: ungiftig
Synonyme:
Alpenmehl, Darmfraß, Drudenfuß, Drudenkraut, Erdschwefel, Erdmoos, Gäbeli, Gichtmoos, Gürtelkraut,
Harnkraut, Hexenkraut, Kolben-Bärlapp, Krampfkraut,
Moosfarn, Schlangenmoos, Teufelsklauen, Waldstaub, Wolfsklaue, Wolfsraute,
Zigeunerkraut
Familie:
Bärlappgewächse (Lycopodiaceae)
Namensentstehung:
Mir nicht bekannt
Beschreibung:
Die vierjährige moosartige, immergrüne Pflanze kriecht in
ein bis zwei Meter langen Ranken mit feinen, dünnen Würzelchen
am Waldboden dahin. Aus den Ranken wachsen 7 - 10 mm lange, sich sehr
weich anfühlende verästelte Stengelchen. Die zapfenförmigen,
etwa 2 - 4 cm langen, aufrechten Sporophyllstände stehen meist
paarweise am Ende der Sprosse. Die in ihren enthaltenen Sporangien entlassenen
zahlreiche Sporen, die erst nach 6 - 7 Jahren keimen und einen Embyo
(Keimling) bilden.
Verwechslung:
Die Pflanze kann sehr leicht mit anderen,
z.T. sehr giftigen Bärlappgewächsen verwechselt werden! Wegen extremer Gefährdung der Pflanze sollte man sie
nicht sammeln.
Sporenreife:
Juli - August
Vorkommen:
Der Bärlapp kommt in Heiden, alten Steinbrüchen, an Berghängen,
in trockenen Nadelwäldern, stets auf kalkarmen, vorwiegend sandigem
Boden von der Ebene bis in die alpine Region (bis zu etwa 2033m) vor.
Bei direkter Sonneneinwirkung, zum Beispiel nach Kahlschlägen,
vergilbt der Bärlapp und verschwindet dann gänzlich, da er
bei direkter Sonneneinstrahlung seinen Lebenswillen verliert.
Verbreitung:
Mit Ausnahme der Steppengebiete und der immergrünen Region des
Mittelmeergebietes ist der Bärlapp über ganz Europa verbreitet.
Sammelgut:
Sporen und Kraut (das Kraut ist in grösseren Mengen tödlich giftig)
Sammelzeit:
August - September
Sammelvorschrift:
Zur Gewinnung der Sporen sammelt man die Fruchtähren und läßt
sie an der Sonne trocknen. Dann werden sie auf einer Unterlage ausgeklopft,
wobei die Sporen herausfallen, die anschließend durch Sieben von
Verunreinigungen befreit werden. Die Droge ist geruchs- und geschmackslos.
Das Sammeln des Krauts ist verboten. Bitte wirklich nicht sammeln, Bärlapp braucht sehr lange bis er wieder wächst.
Inhaltsstoffe:
Die Sporen des Bärlapps, die ein sehr feines, beweliches Pulver
bilden, enthalten bis zu 50% fettendes Öl, 20% Sporonin, Säuren,
Harz, Gummi und Spuren von Alkaloiden. Ferner enthalten sind zelluloseartiges
Kohlenhydrat (Sporonin), Hydrokaffeesäure und Sacharose. Im Kraut sind
giftige Alkaloide (Chinolinalkaloide wie Lycopodin, Clavatin, Lydodolin und Clavotoxin), Flavonoide und Triterpene enthalten.
Anwendung:
Eigenschaften: schmerzstillend, harntreibend, kühlend, blutstillend, krampflösend.
Bärlapptee ist für Gicht- und Rheumakranke, auch
dann wenn sich bereits Veränderungen in den Gelenksformen ergegen
haben, laut Maria Treben
wärmstens zu empfehlen. Für den Tee
nimmt man 1 Teel. Kraut auf 1/4 Liter kochendes Wasser. 1 Minute ziehen
lassen und 1/2 Stunde vor dem Frühstück eine Tasse trinken.
Bei Leberzirrhose und bösartiger Lebererkrankung werden
täglich 2 Tassen getrunken. Nicht mehr davon trinken, da Vergiftungsgefahr besteht.
Der Tee findet auch Verwendung bei allen Erkrankungen der Harn- und
Geschlechtsorgane, Hodenschmerzen- und Verhärtungen, bei
Nierengrieß und Nierensteinen, Nierenkoliken,
Leberentzündungen und krankhaften Veränderungen der Leber.
Laut Maria Treben sogar bei Leberzirrhose.
Bei Krämpfen an Füssen an der Blase oder auch
an alten Kriegs- oder Unfallverletzungen sowie alten schmerzenden
Narben hilft ein Bärlapkissen. Hierfür füllt man ein
Leinsäckchen mit getrocknetem Bärlapp und bindet es fest um
die schmerzende Stelle. So ein Kissen behält bis zu einem Jahr seine
Wirkung.
Die Sporen des Bärlapp können als Wundstreupulver verwendet werden, wenn zum Beispiel die Haut großflächiger aufgewätzt
ist, oder auch beim Wundsein von Babys im Windelbereich.
1 Teil Bärlappsporen auf 10 Teile Milchzucker gemischt und davon 3x täglich eine Messerspitze voll, hilft bei Blasenkatarrh
Keulen-Bärlapp in der Homöopathie:
Lycopodium calvatum wird als aufbauendes Mittel bei chronischen Lebererkrankungen, bei Nieren- u.
Gallensteinen, bei Gicht und Hautkrankheiten, so wie bei allen anderen oben aufgeführten Leiden gegen die Bärlappkraut
innerlich eingenommen hilft. Auf Grund der möglichen Nebenwirkungen des Krautes, sollte man auf diese Mittel ausweichen. Nach der Konstitutionslehre der
Homöopathie eignet sich Lycopodium calvatum für eher wenig sportliche, wenig muskulöse und intelligente Menschen mit Neigung zu Lungenleiden
Hinweis:
Bärlapp niemals kochen,
sondern nur mit kochendem Wasser übergießen!
Nebenwirkungen:
Das Kraut des Bärlapp enthält mehr als 3% toxische (giftige)
Alkaloide. Das Gift wirkt ähnlich wie das von Curare. 0,2g töten Frösche und Mäuse unter Lähmungserscheinungen! Bei geringer Dosierung
sind Reizwirkungen möglich.
Bärlappsoren nicht zu verwenden bei Durchfällen, da sonst Darmkrämpfe entstehen
können. Allergische Reaktionen mit Asthma sind möglich.
Geschichtliches:
Bärlapp ist in seiner Wirkung seit dem frühen Mittelalter
bekannt. Heute wird er kaum noch verwendet.
Quellen:
Die Kräuter in meinem Garten,
Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch,
Giftpflanzen Pflanzengifte,
Die große Enzyklopädie der Heilpflanzen,
Die farbige Kräuterfibel,
Das große Buch der Heilpflanzen,
andere nicht mehr nachvollziehbare Quellen und eigene Zettelwirtschaft.
|

Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)
Bei Klick auf das Bild sehen Sie das Bild in einer Grösse
von 1000 Pixeln Breite
(lange Ladezeit!)

Bilder mit freundlicher Genehmigung von
Kurt Stübers
|