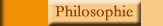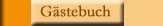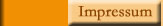Rittersporn
(Delphinium consolida L.) Nebenwirkungen beachten!
Acker-Rittersporn
(Consolida regalis S. F. Gray) Nebenwirkungen beachten!
Synonyme:
Adebarsnibben, Adlerblume, Feld-Rittersporn, Hafergiftblüten, Hornkümmel,
Kreienfoot, Lerchenklau, Ottilienblume
Familie:
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Namensentstehung:
Der Name "Rittersporn" hängt mit dem spornartigen Anhängsel
der Blüten zusammen. Das delphinartige Aussehen der noch geschlossenen
Blüten führte zum botanischen Namen "Delphinum"
Beschreibung:
Der Acker-Rittersporn, auch Feld-Rittersporn genannt, ist einjährig
und inzwischen in Deutschland recht selten geworden. Rittersporn wird
bis 45 cm hoch, die Stiele sind stark verästelt, die Wurzel ist
eine bräunliche Pfahlwurzel. Die Blätter sind grundständig
und kurz gestielt, wogegen die, die weiter oben am Stengel sitzen, ungestielt
sind. Sie sind dreizählig, doppelt bis dreifach geteilt und schmalzipflig.
Die Blüten sind auffällig, recht groß und leuchtend
blau, selten weiß oder rosa und wachsen an langen Stielen, die
deutlich länger sind als die der unteren Blätter. Die Kelchblätter
sind fünfzählig und haben nach hinten einen Sporn der bis
zu 2,5 cm lang sein kann, wodurch die Knospe an einen Delphin erinnert.
Sie stehen in einer lockeren Traube. Die Früchte sind kahle Balgkapseln.
Beim Rittersporn gibt es Unklarheiten, denn lange Zeit wurde der Garten-Rittersporn
und der wilde Rittersporn unter einem Namen gefühlrt, später
wurden die Namen getrennt. Bei überlieferten Anwendungen ist also
nicht ganz klar, welcher Rittersporn gemeint ist, genauso wenig welcher
volkstümliche Name sich auf welchen botanischen Namen bezieht.
Verwechslung:
Die Rittersporn-Arten untereinander.
Delphinum: mehrjährig, 3 Fruchtblätter, dreisamig
Consolida: einjährig, 1 Fruchtblatt, einsamig
Verwendet werden allerdings beide Arten.
Blütezeit:
Mai - August
Vorkommen:
Getreidefelder, Brachäcker, Brachfelder, Feldraine, Weinberge und
Schuttplätze. Selten geworden durch Unkrautvernichtungsmittel
Verbreitung:
Europa, Kleinasien, Armenien
Sammelgut:
Blüten (Calcartippae flos)
Sammelzeit:
Mai - August
Sammelvorschrift:
Die Blüten werden ohne Stiele gesammelt und an einem luftigen,
schattigen Ort nicht über 40°C getrocknet. Aufbewahrt werden
die Blüten am Besten in einem dunklen Glas, wo sie vor Licht geschützt
und trocken bleiben müssen. Die Droge ist geruchslos und hat einen
leicht bitteren, zusammenziehenden Geschmack
Zu den Hinweisen zum Sammeln
und Trocknen
von Kräutern.
Inhaltsstoffe:
Anthocyanglykoside, Flavonoide, Bitterstoff, Gerbstoff, Farbstoff.
Anwendung:
In der Schulmedizin wird Rittersporn nicht verwendet, zumal die Wissenschaft
eine Wirkung der Pflanze bezweifelt. Eine Anwendung der ganzen Pflanze
kann zu Vergiftungserscheinungen führen!
In früheren Zeiten wurden Ritterspornblüten als Wundheilmittel
verwendet. Hierfür wurden 2 - 4 g Blüten mit 1/4 Liter kochendem
Wasser übergossen und 10 Minuten ziehen gelassen, bevor man abseiht.
Mit diesem Tee wurden Wunden ausgewaschen. Innerlich verwendete man
den Tee als harn- und wurmtreibendes Mittel oder wusch sich erkrankte
Augen damit aus.
Blüten des Rittersporns werden auch vielen Blutreinigungstees beigemischt
und dienen in einigen Teemischungen als schmückende Blüte.
Rittersporn ist eine wichtige Pflanze für Hummeln und einige Schmetterlingsarten,
denn der Nektar im Sporn ist nicht für jedes Insekt erreichbar.
Nebenwirkungen:
Blätter, Wurzeln und Stengel haben einen hohen Alkaloidgehalt und
dürfen nicht verwendet werden. Wirkung ähnlich der des blauen
Eisenhuts, aber schwächer.
Auch sind Vergiftungen mit tödlichem Ausgang
bei Tieren sind bekannt.
Rind: Unruhe und Uebererregbarkeit, steifer Gang, später Muskelschwäche
bis Festliegen, Speichelfluss, Vomitus (Gefahr der Aspirationspneumonie!),
Kolik, Tympanie, Muskelzuckungen, evt. Tod durch Atemlähmung.
Schaf: Muskelzuckungen, Paralyse, schaumiger Nasenausfluss, Todesfälle
Rinder und Pferde scheinen empfindlicher zu sein als Schafe. Quelle:
Veterinärtoxikologisches
Institut Zürich
Geschichtliches:
Dioskurides hielt Rittersporn für ein gutes Mittel gegen Schlangenbisse
und empfahl Ritterspornblütentee zu trinken. Auch meinte er, dass
ein Tee gegen Prostataleiden, bzw beschwerliches Wasserlassen hilft.
Gegen Steinleiden und blutigen Harn empfahl er Sitzbäder mit Rittersporn.
In Wein gekocht morgens und abends einen Becher davon getrunken, soll
laut ihm Magenschmerzen vertreiben und Milz, Niere und Blase reinigen
sowie gegen Husten helfen. Äusserlich riet er dazu auch bei entzündeten
Wunden die ganze Pflanze auszupressen und den Saft in die Wunde zu geben.
Quellen: Die
farbige Kräuterfibel, Giftpflanzen
Pflanzengifte, Das
Große Buch der Heilpflanzen, Heilpflanzen
gestern und heute
|
Acker-Rittersporn

Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé
(1885-1905)
Bild mit freundlicher Genehmigung von Kurt
Stübers
Bei Klick auf das Bild sehen Sie das Bild in einer Grösse von 1000
Pixeln Breite
(lange Ladezeit!)
Fotos: L. B. Schwab
Bei Klick auf ein Bild sehen Sie es in einer Gr von 500 Pixeln Breite
Acker-Rittersporn



|